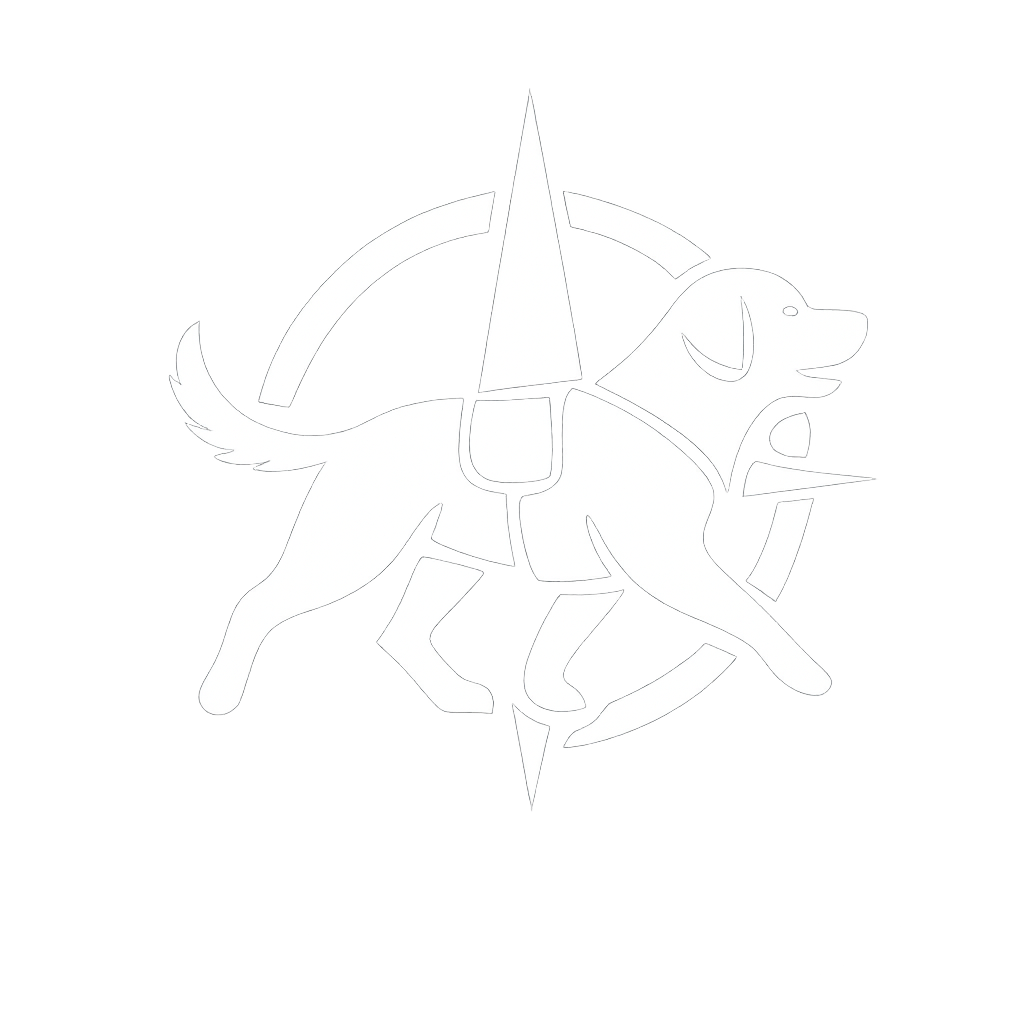Keine Innovation ohne Eigeninitiative
„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
Ein gut ausgebildeter Rettungshund bewegt sich frei und selbstständig durch das Suchgebiet. Er trägt keine Leine, folgt keiner Spur, sondern nimmt die menschliche Witterung aus der Luft auf – ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Erfahrung, Instinkt und Konzentration. Erfahrene Retter wissen: Die besten Hunde arbeiten eigenständig.
Manchmal werden Hunde mit perfekter Systematik quasi millimetergenau durch das Suchgebiet gelenkt. Die Kontrolle wird vom Hundeführer positiv wahrgenommen. Zuschauer bewundern das Handwerk. Prüfungsrichtlinien belohnen diese Teams. Der Hundeführer fühlt sich wichtig und gebraucht, schliesslich unterstützt und kontrolliert er seinen Vierbeiner. Doch solche Hunde sind in der Praxis oft weniger erfolgreich, weil ihre hündischen Stärken weniger zur Geltung kommen. Der Versuch, Kontrolle zu behalten, wird zum Nachteil, wenn dadurch ein Individuum seine eigenen Stärken nicht einsetzen kann – denn der Mensch kann nicht wissen, wie die feine Sensorik der Hundenase tatsächlich arbeitet. Der Hund weiss es. Weshalb also nicht ihn entscheiden lassen?
Die Potenzialentfaltung in der Führung ist dann attraktiv, wenn es der Führungskraft darum geht, Wirkung zu erzielen. Sie ist nicht attraktiv, wenn es darum geht, seine Position zu bewahren und Dritte zu beeindrucken.
Eigeninitiative als Erfolgsfaktor – bei Hund und Mensch
Dieses Prinzip lässt sich direkt auf Organisationen übertragen. Wer Innovation will, braucht Menschen, die Eigeninitiative zeigen – die frei denken, selbstständig handeln und ihre Fähigkeiten entfalten dürfen. Mit Innovation meinen wir nicht nur die grossen Schritte, sondern auch kleine Prozessanpassungen. Die Forschung von Baer & Frese (2003) zeigt: Innovation ohne eigeninitiatives Verhalten der Mitarbeiterschaft kann sich negativ auf die Profitabilität von Firmen auswirken. Schlussfolgerung für Firmen, in denen die Kultur von Angst vorherrscht und wo die Mitarbeiterschaft auf Anweisungen von oben warten, bevor sie agieren: Investiert nicht in Innovation, Organisation, Change-Management und revolutionäre Prozessverbesserungen. Denn jede Änderung bringt immer auch die Notwendigkeit von kleinen Anpassungen und Feinjustierungen mit. Und wenn dann die Mitarbeiterschaft nicht proaktiv handelt entstehen Probleme, welche die Profitabilität der Firma sogar noch reduzieren. Gestaltet zuerst das Umfeld.
Woher kommt Proaktivität?
Die Gene spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Entscheidend sind Erfahrungen und das Umfeld. Menschen zeigen nur dann selbststartendes Verhalten, wenn sie sich zutrauen, ein Ziel aus eigenen Kräften zu erreichen. Natürlich hilft es, bei der Rekrutierung Menschen zu berücksichtigen, die von Natur aus (Genetik / frühkindliche Erfahrungen) proaktiv agieren. Es macht aber mehr Sinn auf einen mannigfaltigen Erfahrungsschatz zu achten. Lückenhafte Lebensläufe, sofern diese Lücken positiv genutzt wurden, können ein Zeichen für einen breiten Erfahrungsschatz und damit Zeuge von grosser Selbstwirksamkeit sein. Solche Bewerbungen sollten also nicht vorweg einfach verworfen werden. Da aber Rekrutierung keine exakte Wissenschaft ist, benötigt die Firma eine Führungskultur, die Erfahrungen bei der Mitarbeiterschaft gezielt fördert.
Führung bedeutet: Erfahrungen ermöglichen
Führungskräfte sind in dieser Kultur die Trainer ihrer Mitarbeiter. Durch gezielte Delegation führen sie ihr Team in kurzzeitige Überforderung und schaffen somit neue Erfahrungen. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, auf dem Weg über Fehler einen Lernprozess durch zu machen. Nur wenn sie möglichst eigenständig das Ziel erreichen entsteht auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit.
Kurz: Führungskräfte stehen in der Pflicht, Erfahrungen zu erlauben – und manchmal sogar zu provozieren. Nur wer erlebt, dass er selbst Probleme lösen kann, gewinnt Vertrauen in die eigene Wirksamkeit. Dieses Gefühl – „Ich kann das“ – ist der Ausgangspunkt für jede Form von Proaktivität und Innovation.
Psychologische Sicherheit als Nährboden
Am wichtigsten ist jedoch das Umfeld. Menschen (und Hunde) brauchen Sicherheit, um mutig zu sein. Ein Umfeld, in dem psychologische Sicherheit herrscht – wo Fehler erlaubt, Fragen erwünscht und Ideen willkommen sind – schafft genau diesen Raum. Dazu gehört auch eine positive Fehlerkultur: Wer Angst vor Fehlern hat, bleibt passiv. Wer Fehler als Lernchance sieht, entwickelt sich weiter. Nur in einem solchen Umfeld können proaktive Mitarbeiter gehalten werden. Es ist die Aufgabe jeder Führungskraft für ihr Team ein solches Umfeld zu schaffen, auch wenn das manchmal bedeutet, sich bei Vorgesetzten oder Kollegen unbeliebt zu machen.
Fazit: Vertrauen statt Kontrolle
So wie der gute Rettungshundeführer seinem Partner vertraut, sollten Führungskräfte ihren Mitarbeitenden vertrauen. Denn Kontrolle erstickt Eigeninitiative, während Vertrauen (Zutrauen) sie wachsen lässt. Innovation entsteht dort, wo Menschen – wie Rettungshunde – sich frei bewegen, ihre Stärken einsetzen und selbstständig entscheiden dürfen.