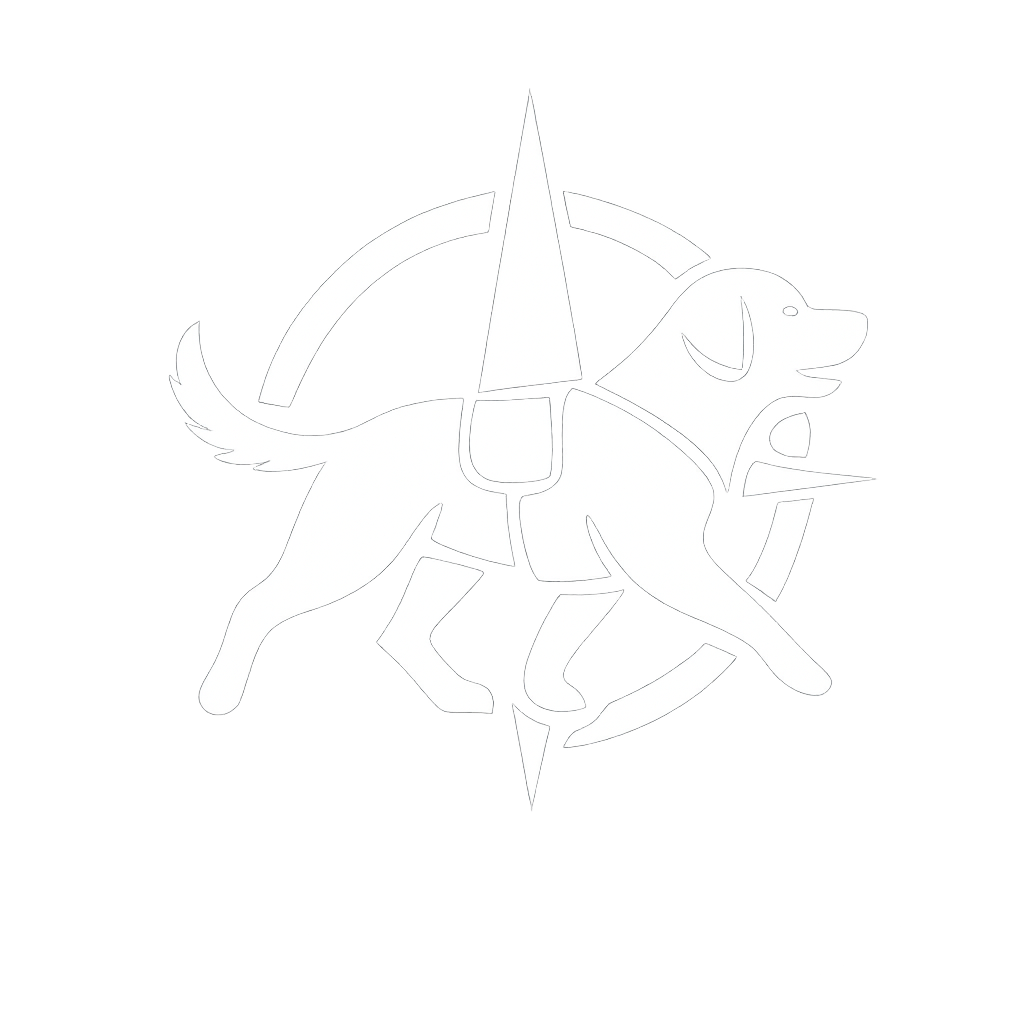Vertrauen – verdient oder geschenkt?
„Der beste Weg herauszufinden, ob man jemandem vertrauen kann, ist ihm zu vertrauen.“
Bei der Arbeit mit Rettungshunden ist Vertrauen keine Kür, sondern Voraussetzung. Ein Hundeführer kann seinen Hund nicht ständig kontrollieren – nicht im Wald, nicht im Nebel, nicht im Dunkeln. In diesen Momenten muss er darauf vertrauen, dass der Hund selbständig sucht, seine Nase nutzt, Entscheidungen trifft und die Verantwortung für seine Aufgabe übernimmt.
Fehlt dieses Vertrauen, beginnt der Hundeführer zu steuern: Er ruft häufiger, gibt Kommandos, beobachtet nervös. Der Hund reagiert – und richtet seine Aufmerksamkeit zunehmend auf den Menschen statt auf die Suche. Die Folge: Energie fliesst in soziale Rückversicherung („Mache ich es richtig?“) statt in die eigentliche Arbeit. Die Nase, das wichtigste Werkzeug des Hundes, bleibt sprichwörtlich „aus“. Potenzial bleibt ungenutzt.
Was im Suchgelände gilt, gilt auch in der Führung von Menschen.
Vertrauen als Grundlage – nicht als Belohnung
In der Diskussion mit einem Coach via LinkedIn-Portal schrieb er mir kürzlich: „Vertrauen muss sich ein Mitarbeiter erst verdienen.“ Ein Satz, der oft als selbstverständlich gilt – und doch in mir Widerspruch auslöst.
Wenn ich als Führungskraft einen Mitarbeitenden auswähle, dann habe ich mich bereits entschieden: für seine Kompetenzen, seine Haltung, sein Potenzial. Wieso sollte ich also erst auf Beweise warten, bevor ich vertraue? Wie muss er sich beweisen, damit ich ihm vertrauen kann? Oder wäre es nicht doch eher an der Führungskraft den Bereich zu ermitteln, wo vertraut werden kann? Kann man nicht jedem Individuum in einem definierten Bereich vertrauen? Gute Führungskräfte nehmen eine aktive Rolle ein und warten nicht passiv, bis sie jemandem vertrauen können.
Ich bin überzeugt: Vertrauen kann eine Belohnung für vergangene Leistungen sein, muss es aber nicht. Gerade zu Beginn einer Zusammenarbeit ist es immer eine bewusste Führungsentscheidung. Es ist der Startpunkt, nicht das Ergebnis. Danach geht es um die Weiterentwicklung und Stärkung von Vertrauen. Durch gezielte Förderung wird die Zone des Vertrauens auf neue Gebiete ausgedehnt. Auch hier braucht es immer wieder einen Vertrauensvorschuss, also das Zutrauen, auch in herausfordernden Situationen erfolgreich zu sein.
Vertrauen zu schenken bedeutet, einem Menschen etwas zuzutrauen – und ihn durch gezielte Delegation in neue, vielleicht auch fordernde Situationen zu führen. So entstehen nicht nur fachliche Fortschritte, sondern auch Selbstvertrauen und Resilienz, wichtige Eigenschaften für eigeninitiatives Verhalten.
Vertrauen darf kurzfristig überfordern
Vertrauen heisst nicht, die Kontrolle völlig aufzugeben. Es heisst, einen kontrollierten Rahmen zu schaffen, in dem Lernen möglich ist. Dazu gehört, dass Herausforderungen gelegentlich in die Überforderung reichen dürfen – denn dort beginnt Entwicklung. Je besser die Führungskraft den Mitarbeiter kennt, desto präziser kann delegiert werden. Motivational am Günstigsten ist es, dass der Mitarbeiter selbstständig ein möglichst herausforderndes Ziel erreichen kann.
Auch im Training eines Rettungshundes steigert man die Anforderungen Schritt für Schritt. Man beobachtet, begleitet, greift bei Bedarf ein – aber man lässt den Hund wenn immer möglich die Lösung selbst entwickeln. So wächst seine Sicherheit, sein Problembewusstsein, seine Erfahrung. Vertrauen ist ein Wachstumsprozess.
Führung funktioniert genauso: Nur wer Freiraum bekommt, kann Selbstwirksamkeit erleben. Vertrauen bedeutet also nicht passives „Gewährenlassen“, sondern aktives Ermöglichen.
Forschung: Warum Vertrauen wirkt
Die Wissenschaft bestätigt, was Hundeführer längst wissen: Vertrauen wirkt – und zwar beidseitig.
1. Felt Trust (de Jong et al., 2025)
Wenn Mitarbeitende spüren, dass ihnen vertraut wird („felt trust“), steigt ihre Motivation, Kreativität und Lernbereitschaft. Dieses wahrgenommene Vertrauen aktiviert Selbstverantwortung. Unrealistisches Zutrauen kann aber auch zu Überforderung führen und als Druck wahrgenommen werden.
2. Trust and Delegation (Gur, 2017)
Führungskräfte, die Vertrauen schenken, delegieren mehr Verantwortung. Dadurch entsteht höhere Produktivität, schnellere Entscheidungsfähigkeit und nachhaltigeres Engagement. Vertrauen senkt die „Kosten der Kontrolle“ und fördert echte Zusammenarbeit.
3. Trust in Management (Meagher & Wait, 2023)
Vertrauen schafft eine Kultur, in der Eigenverantwortung funktioniert. Wo Vertrauen fehlt, steigen Kontrollaufwand und Reibungsverluste – ein Muster, das viele Organisationen aus der Praxis kennen.
Vertrauen als Führungsaufgabe
Die zentrale Frage lautet also nicht:
Hat sich mein Mitarbeiter Vertrauen verdient?
Sondern:
Schaffe ich als Führungskraft die Bedingungen, unter denen Vertrauen wachsen kann?
Denn wer vertraut, geht immer ein kalkuliertes Risiko ein. Doch ohne diesen Schritt – ohne den ersten Vertrauensvorschuss – bleibt Entwicklung unmöglich. Vertrauen ist damit nicht nur Ausdruck von Mut, sondern von professioneller Verantwortung: Es befähigt Menschen, über sich hinauszuwachsen, Erfahrungen zu sammeln und Initiative zu zeigen. Und für alle die noch nicht überzeugt sind und einen Rettungsring benötigen: Vertrauen kann auch entzogen werden.
Fazit:
Kontrolle gibt Sicherheit – Vertrauen schafft Leistung.
Rettungshund mit Bringsel aus dem Kanton Tessin, Border Collie